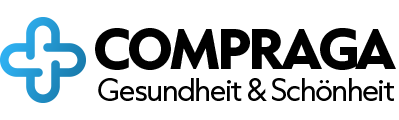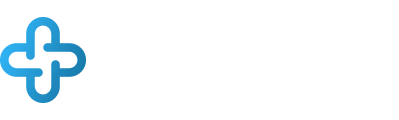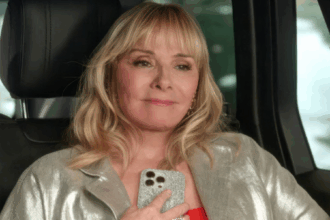Die Kunst der Fiktion: Die dunkle Verbindung zwischen Realität und Unterhaltung
Einleitung
Oscar Wilde formulierte in seinem Essay "The Decay of Lying" (1891), dass das Leben die Kunst viel mehr imitiert als die Kunst das Leben. Diese These scheint 130 Jahre später mit der Premiere von The Handmaid’s Tale im Jahr 2017 eindringlich bestätigt worden zu sein — einem Jahr, das die #MeToo-Bewegung und die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA erlebte. Die dystopische Serie wurde schnell populär und eröffnete einen negativen Trend in der Fernsehunterhaltung, der die Zuschauer mit grotesken Geschichten konfrontierte, die die düstere Realität für viele Frauen widerspiegelten. Doch angesichts der realen Unterdrückung und der regressionierten Frauenrechte, die uns umgeben, ist die Frage berechtigt: Brauchen wir eine fiktive Darstellung dieser beklemmenden Wahrheiten?
Die Dystopie von Margaret Atwood
Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht Margaret Atwoods Roman von 1985, der die Grundlage für die Serie bildet. Der dystopische Schauplatz, in dem Frauen systematisch unterdrückt werden, hat sich in erschreckender Weise mit den aktuellen politischen und sozialen Entwicklungen verbunden. Die TV-Serie expandierte die Erzählung über Atwoods ursprünglichen Rahmen hinaus, um eine düstere und oft schockierende Maschinerie des tv-unterhaltenden Horrors zu schaffen. Ich selbst konnte nach der ersten Staffel nicht mehr hinschauen und stellte mir die Frage, wie das Qualen von Frauen je als Unterhaltung angesehen werden konnte.
Der reale Horror für Frauen
In den letzten Jahren fühlte sich die Welt oft wie ein düsterer Ort für Frauen an. Körper, Rechte und Stimmen werden von mächtigen Männern, die sich durch die #MeToo-Bewegung bedroht fühlen, seziert. Die Realität ist bereits komplex und bedrückend genug, ohne sie durch die Linse einer verstörenden Fiktion noch verstärken zu müssen. The Handmaid’s Tale erinnert uns jedoch konstant an die wirklichen Kämpfe, die Frauen weltweit ausstehen müssen. Die Erzählungen in der Serie sind nicht nur eine warnende Allegorie, sondern vielmehr ein Spiegel für die nahe Zukunft.
Entfremdung vom Drama
Die Reaktionen auf die letzten Staffeln der Serie sind gemischt. Abigail Southan, Redakteurin bei ELLE UK, sprach über den emotionalen Schmerz, den sie empfand, als die Hauptfigur June im Van nicht entkam. Für sie war es schwer, an einer Serie festzuhalten, die mehr Wert auf kommerziellen Erfolg als auf gute Erzählstrategie schien zu legen. Ein ähnliches Gefühl äußerte Rhiannon Evans, ebenfalls bei ELLE UK, wobei sie die Entscheidung der Showmacher kritisierte, die Handlung unnötig zu strapazieren, wodurch das Interesse der Zuschauer schwand. Während die erste Staffel noch ergreifende Wahrheiten thematisierte, fühlte sich die dritte Staffel wie eine absichtliche Strafe für die Protagonistin an.
Zuschauerinteresse und Realität
Trotz der kritischen Stimmen bleibt das Interesse an The Handmaid’s Tale ungebrochen. Die fünfte Staffel verzeichnete in der ersten Woche 581 Millionen Zuschauer weltweit. Laut Parrot Analytics liegt die Nachfrage in den USA 38,6-mal über dem Durchschnitt aller TV-Serien. Es ist faszinierend, dass die Zuschauer bereit sind, Frauen im Fernsehen zu beobachten, die ihre Körperhoheit verlieren, während sie gleichzeitig in einer Welt leben, in der ähnliches geschieht. Diese Diskrepanz zwischen fiktionaler und realer Handlung wirft grundlegende Fragen zur Natur der Unterhaltung auf.
Fazit: Kunst oder Grauen?
Im Endeffekt bleibt die Frage, warum die Menschen derartige Narrative konsumieren wollen, wenn die Realität oft noch schlimmer ist. Die Dystopie von The Handmaid’s Tale dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch als eine erschreckende Warnung vor dem, was geschehen kann, wenn gesellschaftliche Normen ins Wanken geraten. Obwohl die Serie das Oeuvre von Atwood respektiert, muss man sich fragen, ob es wirklich notwendig ist, sich einem solchen Grauen auszusetzen, während die Realität direkt vor unseren Augen leidet. Die Welt braucht nicht noch mehr Erinnerungen an das Elend von Frauen; vielmehr sollte die Kunst ein Raum für Heilung und Hoffnung sein.